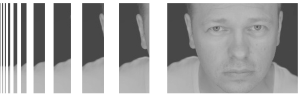Durch Geschichtsvergessenheit und mangelnde Abgrenzung nach links schadet die SPD vor allem sich selbst
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 gestaltete sich die Abgrenzung der SPD zur SED-Nachfolgepartei als kontinuierlicher Erosionsprozess. War eine Zusammenarbeit mit der PDS zunächst noch auf starke Vorbehalte inner- wie außerhalb der Sozialdemokratie gestoßen, dauerte es gerade einmal bis 1994, bis der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reinhard Höppner seine rot-grüne Minderheitsregierung von der PDS tolerieren ließ. Vier Jahre später, 1998, kam es in Mecklenburg-Vorpommern zur ersten „echten“ rot-roten Koalition unter Harald Ringstorff (, die immerhin bis 2006 andauerte). Es folgten Berlin (2002 bis 2011), Brandenburg (seit 2009) und Thüringen (seit 2014), wo die Linke mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt und die SPD sich mit der Rolle des Juniorpartners begnügt.
In der SPD wurde dieser Annäherungsprozess mehrheitlich mit Wohlwollen begleitet. Erst kürzlich spekulierte der sozialdemokratische Publizist Nils Heisterhagen in der Zeitung Die Welt über eine mögliche rot-rote Koalition im Bund ab 2021 und träumte von einer „Wiedervereinigung der deutschen Linken“. Diese Hoffnung mag angesichts der Geschichte der Deutschen Teilung befremden, dennoch können sich beide Parteien auf gemeinsame Wurzeln berufen. Die maßgeblichen Gründer der KPD, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, waren nicht nur jahrelang SPD-Mitglieder, sondern prägten diese Partei in einer entscheidenden Zeit in führenden Funktionen. Liebknecht, dessen Vater Wilhelm zu den Gründervätern der SPD gehörte, war von 1900 an Parteimitglied und zog 1912 als Abgeordneter in den Reichstag ein. Luxemburg gehörte seit 1898 der Partei an und avancierte schnell zur Galionsfigur der Parteilinken.
Die Trennung in zwei ideologische Strömungen begann bereits kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten, die von der Obersten Heeresleitung erbetenen worden waren, lehnten Luxemburg und Liebknecht ab. Im Dezember 2014 stimmte Liebknecht als einziger SPD-Abgeordneter gegen die Kredite. Gemeinsam organisierten sie sich in der Spartakusgruppe und versuchte zunächst über diese, Einfluss innerhalb der SPD zu gewinnen. Diese Strategie änderte sich spätestens unter dem Eindruck der Revolution in Russland 1917. Während der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert, der infolge der Novemberrevolution zum Reichskanzler avanciert war, die revolutionären Verhältnisse beenden und eine Demokratie nach westlichem Modell einführen wollte, strebten die USPD und später die von Liebknecht und Luxemburg gegründete KPD die Fortführung der Revolution bis zur Herrschaft des Kommunismus an.
Die Niederschlagung der Kommunistenaufstände nach der Abdankung Wilhelms II. war keineswegs das alleinige Werk nationalistischer oder kaisertreuer Verbände. Maßgeblich gesteuert wurden sie von der sozialdemokratischen Reichsregierung: Gustav Noske, langjähriges SPD-Mitglied und Reichswehrminister rekrutierte Freikorps und ging mit aller Härte gegen die antidemokratischen Putschversuche vor. Überliefert ist die Weisung Noskes bei den Berliner Märzkämpfen 1919, nach der jeder, der sich mit der Waffe in der Hand gegen die Regierungstruppen stelle „sofort zu erschießen“ sei. Bei diesen schwersten revolutionären Auseinandersetzungen auf deutschem Boden starben insgesamt etwa 1.200 Menschen. Und auch die Niederschlagung des so genannten Spartakusaufstandes, infolge dessen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden, trug die Handschrift Noskes. Unklar ist, ob Noske von den Plänen zur Ermordung Luxemburgs und Liebknechts gewusst oder gar seine Zustimmung gegeben hatte – so wie dies Waldemar Pabst, der verantwortliche Freikorpsoffizier, in den Nachkriegsjahren wiederholt behauptet hatte.
Es ist schwer vorstellbar, dass die in der Tradition Luxemburgs stehende Partei Die Linke jemals über die Politik der SPD in der Weimarer Zeit hinwegsehen könnte. Umgekehrt hingegen, führten die revolutionären antidemokratischen und Bestrebungen und gewaltsamen Umsturzversuche der KPD keineswegs zu einer einheitlichen Distanzierung der Sozialdemokraten – selbst dann nicht, als nach dem Zweiten Weltkrieg SPD und KPD in der Sowjetisch Besetzten Zone zur Sozialistischen Einheitspartei zusammengeführt wurden. Einige Historiker stellen den Begriff der „Zwangsvereinigung“ daher heute infrage. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diejenigen, die sich der von der stalinistischen Besatzungsmacht vorgegebenen Parteienvereinigung nicht beugen wollten, massive Nachteile erdulden oder fliehen mussten. Die trotzigen SPD-Mitglieder verschwanden in sowjetischen Speziallagern – und damit nicht selten an denselben Orten, an denen sie zuvor von den Nationalsozialisten interniert worden waren. Etwa 5.000 Sozialdemokraten wurden nach Historikerschätzungen in die Lager gesperrt. Viele teilten das Schicksal des SPD-Politikers Dieter Rieke, der wegen seiner fortbestehenden Kontakte zur West-SPD zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt und, nachdem er an einer Häftlingsrevolte teilgenommen hatte, vier Jahre in Einzelhaft gesperrt wurde. Etwa 400 inhaftierte SPD-Mitglieder verloren infolge der schlechten Bedingungen in den Lagern ihr Leben.
Prägten diese historischen Ereignisse in den frühen Jahren der Bundespublik noch das Selbstverständnis der SPD, insbesondere von Politikern wie Kurt-Schuhmacher, spielten sie mit zunehmender Zeit eine immer geringere Rolle, sodass sich in den neunziger Jahren die beschriebenen Koalitionsoptionen auftaten. Der Umstand, dass die PDS bzw. die Linkspartei vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, hatte dabei augenscheinlich wenig bis keinen Einfluss. Und auch heute noch – trotz Etablierung und Volksparteicharakter in den östlichen Bundesländern – werden Gruppen innerhalb der Partei wie die Kommunistische Plattform (KPF) und die Antikapitalistische Linke (AKL) als offene extremistische Zusammenschlüsse vonseiten des Verfassungsschutzes beobachtet. „Punktuell“ sei dabei auch von einer Zusammenarbeit mit Gruppierungen des gewaltorientierten Spektrums auszugehen, wie erst kürzlich in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des niedersächsischen AfD-Politikers Stefan Bothe hervorging (Drs. 18/1823). Die linksradikale Ausrichtung gilt dabei nicht nur für kleine parteiinterne Splittergruppen, sondern auch für die Jugendorganisation der Partei („Linksjugend Solid“). Zu Weihnachten 2018 wünschte sie sich in einem Facebook-Text „full Communism“.
Einen Nutzen, wie ihn etwa die Hamburger CDU aus der umstrittenen Koalition mit der Schill-Partei gezogen hatte, konnte die SPD aus der Verbindung mit der Linken nicht ziehen. Tatsächlich zog sich die SPD durch die Koalitionen einen Konkurrenten im eigenen Lager heran und manövrierte sich im Parteiensystem in eine denkbar ungünstige Position. Während sich die Union von ihrem konservativen Flügel abwandte und neue Wähler in der linken Mitte umwarb, gelang es der Linkspartei sowohl linksradikale Wähler, klassische Arbeiterschichten als auch – mit dem Flügel um Sarah Wagenknecht – zuwanderungsskeptische Wählerschichten anzusprechen und 2005 mit Oscar Lafontaine einen sozialdemokratischen Popstar abzuwerben.
Die SPD setzte dagegen auf Themen, mit denen die bisherigen arbeiterdominierten Wählerschichten nicht mobilisiert werden konnten, wie den Klimawandel, Minderheitenrechte und Gender-Mainstreaming. Das SPD-Führungspersonal, wie etwa Generalsekretär wie Lars Klingbeil oder die aktuelle Vorsitzende Andrea Nahles, wirkt im Vergleich zu ihren historischen Maßstäben farblos. Wer zudem die populistischen Aussagen oder die verbalen Entgleisungen von Protagonisten wie Ralf Stegner oder Johannes Kahrs betrachtet, dem erscheinen die Spitzenpolitiker der Linken geradezu seriös. Der Aufstieg der AfD und ihr Einbrechen in sozialdemokratische Wählerschichten fügten der SPD weiteren Schaden zu, und ihre Zustimmungswerte sanken kontinuierlich. Noch vor 20 Jahren lagen die Wahlergebnisse der SPD bei etwa 40 Prozent, in aktuellen Wahlumfragen erreicht sie im Schnitt noch nicht einmal mehr die Hälfte. In Bayern erzielte sie bei der vergangenen Landtagswahl mit 9,7 Prozent das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. In Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt sie in Umfragen derzeit nur knapp über 10 Prozent.
In der SPD führten diese Entwicklungen jedoch nicht zu einem strategischen Umdenken. Hatte Sigmar Gabriel eine Zusammenarbeit auf Bundesebene noch 2010 kategorisch ausgeschlossen, ist es heute eine Frage der Zeit, wann die erste rot-rote Zusammenarbeit auch auf Bundesebene initiiert wird. Nachdem selbst in der CDU kürzlich erste Gedankenspiele über mögliche Koalitionen mit der Linken öffentlich diskutiert wurden, allen voran durch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, ist eine Wende in der Koalitionspolitik der SPD nicht zu erwarten. Carsten Schneider, parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, erklärte erst kürzlich, er hoffe, es komme innerhalb der Linksfraktion zu einer Entspannung gegenüber der SPD. Schneider ist in der Zusammenarbeit mit der Linken erfahren. Er hatte bereits 2014 die rot-rote Koalition in Thüringen mitgestaltet.
Am Ende der sozialdemokratischen Sehnsucht nach „Wiedervereinigung“ der linken Bewegung könnte der weitere Aufstieg der Linkspartei und der Untergang der Sozialdemokratie stehen. Denn – so viel steht fest – das Verhältnis von SPD und Linkspartei ist eine einseitige Liebesbeziehung.